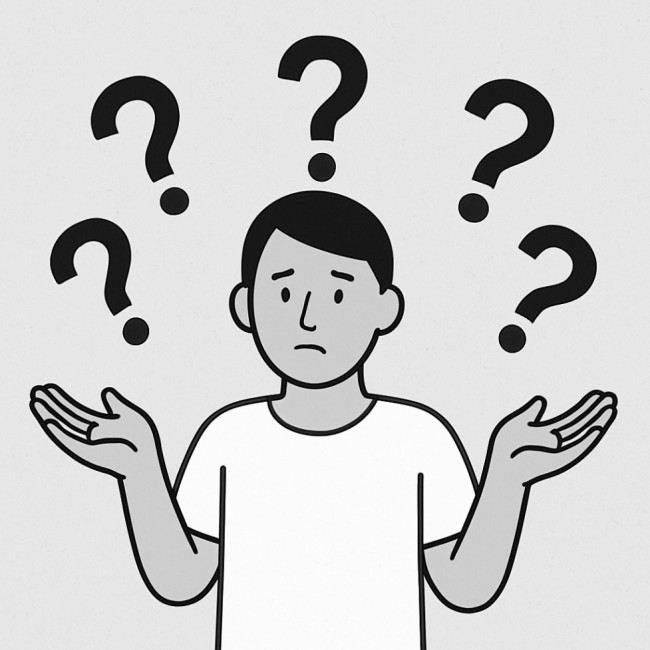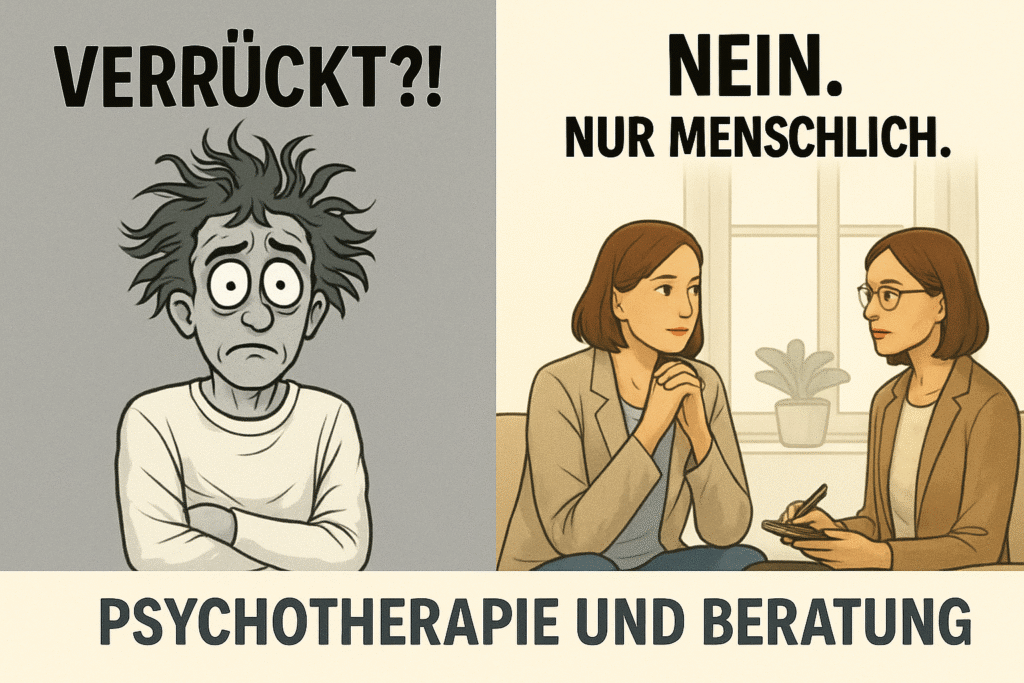
Viele Menschen tragen Vorstellungen über Psychotherapie in sich, die eher aus Filmen stammen als aus der Realität. Da liegt man auf einer Couch, erzählt endlos von der Kindheit, während jemand schweigend Notizen macht. Überhaupt geht es immer nur um die Kindheit und Therapeut*Innen wühlen im Kopf der Leute herum. Andere meinen: „Reden bringt doch sowieso nichts“, Therapeut*Innen haben doch selber alle „einen an der Waffel“ oder Therapie sei nur etwas für verrückte. Solche Klischees und Vorurteile halten sich hartnäckig, haben aber wenig mit der Realität zu tun. Leider halten Sie nicht wenige davon ab, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Doch was ist Psychotherapie wirklich? Wobei kann sie helfen? Und woran kann ich erkennen, ob sie für mich sinnvoll sein könnte?
Was ist Psychotherapie?
Psychotherapie ist mehr als nur Reden – sie ist ein wissenschaftlich fundiertes Verfahren, das bei psychischen Erkrankungen, chronischem Stress, Trauma, Borderline oder auch Post-Covid und anderen körperlichen Erkrankungen helfen kann. Doch viele wissen nicht, was eine Psychotherapie eigentlich ist, wie sie abläuft und ob sie wirklich sinnvoll ist. In diesem Beitrag erfährst du alles Wichtige.
In der Psychotherapie dürfen nur solche Techniken oder Verfahren genutzt werden, die auch in qualitativ hochwertigen wissenschaftlichen Studien untersucht worden sind und für hilfreich im Vergleich zu keiner Behandlung oder einer anderen Behandlung, befunden wurden. Die Psychotherapie hilft Menschen dabei, ihr Erleben und Verhalten besser zu verstehen, belastende Muster zu verändern und psychische Erkrankungen zu bewältigen oder zu heilen. Man könnte auch sagen es hilft dabei, sich selber zu helfen und ist damit eine „Hilfe zur Selbsthilfe“. Handlungsfähiger werden und das Leben so zu gestalten, wie man es sich wünscht, ohne hilflos den eigenen (möglicherweise nicht hilfreichen) Gefühlen, Gedanken und Verhaltensweisen gegenüber zu stehen, das ist das Ziel.
Um eine Psychotherapie in Anspruch nehmen zu können, braucht es eine Diagnose, wie beim Arzt auch. Durch die Diagnose wird vor allem geklärt, dass ein erheblicher Leidensdruck besteht, der eine Behandlung notwendig macht. Damit ist der rechtliche Rahmen geschaffen, eine Kostenübernahme für die Psychotherapie von den Krankenkassen zu erhalten.
Welche psychotherapeutischen Verfahren gibt es?
In Deutschland sind aktuell vier Verfahren von den Krankenkassen anerkannt:
-
- Verhaltenstherapie (VT):
Fokussiert auf aktuelle Denk- und Verhaltensmuster und wenn relevant auf frühere Erlebens- und Verhaltensmuster. Ziel ist es, konkrete Strategien zur Problembewältigung zu erarbeiten und neue, hilfreiche Verhaltensweisen einzuüben.
- Verhaltenstherapie (VT):
-
- Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie (TP):
Geht davon aus, dass unbewusste Konflikte, meist aus der Biografie, heutiges Erleben beeinflussen. Es wird vor allem im Gespräch an diesen inneren Zusammenhängen gearbeitet.
- Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie (TP):
-
- Analytische Psychotherapie:
Zentral ist die Fokussierung auf unbewusste Prozesse und frühe Kindheitserfahrungen. Sie ist meist langandauernder, in der klassischen Version finden die Termine mehrmals die Woche statt.
- Analytische Psychotherapie:
-
- Systemische Therapie:
Betrachtet psychische Probleme im Kontext sozialer Beziehungen, vor allem der Familie. Ziel ist es, Dynamiken zu verstehen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln.
- Systemische Therapie:
Welches Verfahren das passende ist, hängt unter anderem von der Art der Beschwerden, den persönlichen Zielen und der Passung ab. Dafür gibt es die Erstgespräche bzw. Sprechstunden, in denen u.a. geklärt werden soll, welches Verfahren für die jeweilige Person bzw. Symptomatik Sinn macht. Am besten Sie informieren sich vorab auch schon mal selber, z.B. in dem Sie die o.g. Begriffe in die Suchmaschine eingeben und sich etwas über die Verfahren informieren. Manchmal spürt man da schon ganz gut, was zu einem passen könnte und was nicht. Gleichzeitig sind das dann immer nur sehr oberflächliche Beschreibungen von dem, was eigentlich passiert. Innerhalb des jeweiligen Verfahrens, arbeiten die einzelnen Therapeut*innen auch teilweise nochmal sehr unterschiedlich.
Ablauf einer Psychotherapie: Von Erstgespräch bis Antrag
Eine Psychotherapie beginnt in der Regel mit der sogenannten „Sprechstunde„, Kassenzugelassene Kolleg*innen dürfen davon insgesamt 3 abrechnen. Hier lernt man sich erstmal kennen und klärt grob den Grund der Behandlung und erhält eine Empfehlung für das Verfahren. Dann geht es weiter mit den sogenannten „probatorischen Sitzungen„. Diese dienen dem weiteren Kennenlernen, der diagnostischen Einschätzung und auch der Aufstellung eines gemeinsamen Planes für die Behandlung. Eine erste Problemanalyse (Erklärungsmodell) erfolgt, es wird gemeinsam überlegt, wo soll es hingehen, was könnten Ziele sein? Wie könnte man dahin kommen (Therapieplan)?
Wenn ein Antrag bei der Krankenkasse gestellt wird und bewilligt ist, kann die eigentliche Behandlung beginnen. Die Dauer einer Psychotherapie variiert je nach Verfahren und Bedarf. Kurzzeittherapien umfassen oft 12–24 Sitzungen, Langzeittherapien können mehrere Monate bis Jahre dauern. In meiner Praxis in Berlin besprechen wir gemeinsam, was sinnvoll erscheint, Sie haben immer das letzte Wort.
Wer übernimmt die Kosten für die Psychotherapie?
Bei approbierten Psychotherapeutinnen mit Kassenzulassung übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten. Leider werden keine neuen Kassensitze freigegeben, sodass Sitze meist nur frei werden, wenn jemand in Rente geht. Dadurch haben viele Kolleg*innen keine Kassensitze und können nicht mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. So ist es auch bei mir. Viele private Kassen erstatten psychotherapeutische Leistungen (abhängig vom individuellen Vertrag). Privatpraxen für Psychotherapie rechnen nach der nach der Gebührenordnung für Psychotherapeut*innen, GOP, ab. Weitere Informationen hierzu finden Sie in meinen Häufige Fragen – FAQ´s
Ist Psychotherapie das Richtige für mich?
Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten, wenn Sie sich diese Frage aber stellen, verdient sie eine ernsthafte Auseinandersetzung. Psychotherapie ist kein „Allheilmittel“, aber ein wertvoller Weg, um seelisches Leid zu lindern, innere Klarheit zu gewinnen und Veränderungsprozesse zu begleiten.
Einige Hinweise, dass eine Psychotherapie hilfreich sein könnte:
-
- Symptome und Probleme, die immer wieder auftauchen, bei denen Sie sich hilflos fühlen. Es übersteigt Ihre Kapazitäten, Sie wissen nicht, wie Sie anders damit umgehen sollen. Also kurz gesagt, wenn Probleme einem über den Kopf wachsen und man nur versucht zu überleben. Man funktioniert nur noch.
-
- Sie leiden unter anhaltende Schlafstörungen, Niedergeschlagenheit, Angst oder innerer Unruhe, Grübeleien
-
- Beziehungen oder der Alltag sind dauerhaft belastet. Menschen wenden sich ab, es gibt viel Streit oder unausgesprochenes
-
- Sie haben den Wunsch sich selbst besser zu verstehen und alte Muster zu verändern.
-
- Sie wollen ausbrechen aus alten Teufelskreisen und endlich ein Leben leben, dass lebenswert ist.
-
- Ein Gefühl von: „So wie es ist, kann es nicht bleiben. Ich halte es nicht mehr aus“
Auch bei spezifischen Herausforderungen wie Post-Covid, Endometriose, emotionaler Instabilität (z. B. Borderline), chronischer Erschöpfung kann Psychotherapie eine sinnvolle Unterstützung sein – je nach Bedarf mit unterschiedlichen Methoden wie DBT, Verhaltenstherapie oder Traumatherapie.
Sich Hilfe zu holen, ist kein Zeichen von Schwäche – sondern von Mut. Psychotherapie ist keine Pille, die Probleme löst. Aber sie kann Entlastung schaffen, Verbindung bringen, ein sicherer Hafen sein und ein Ort sein, um sich selber besser Kennenzulernen und Auszuprobieren. Es ist wichtig sich als Team zu verstehen, das gemeinsam auf dem Weg zu einem besseren Leben arbeitet.
Damit es einem besser geht, müssen Dinge anders werden. Es ist unter anderem Ziel der Therapie herauszufinden welche genau. Damit dann wirklich etwas anders wird, müssen neue Wege gegangen werden. Es ist manchmal schwer, steinig, schmerzhaft, wahnsinnig herausfordernd und anstrengend. Nur Sie selber können, zusammen mit der passenden Unterstützung, Ihr Leben und Ihre innere Welt anders gestalten und das ist es meist absolut wert.
Das wichtigste, auf dem Weg sich Unterstützung zu holen, ist, dass man ein gutes Grundgefühl hat bei der behandelnden Person, ein Gefühl von „ich fühle mich ausreichend wohl“. Manchmal weiß man das nicht direkt, das ist auch okay. Dann kann man einfach weiter schauen und darauf achten. Wenn Sie dann merken, Sie haben ein „Störgefühl“, dann sprechen Sie das einfach an, dafür sind wir geschult und das gehört dazu, so kann man dann nach einer gemeinsamen Lösung zu suchen. Denn wir wissen, dass die Beziehungsqualität einen großen Einfluss auf den Therapieerfolg hat.
Ist Psychotherapie nur für Verrückte?
Abschließend noch zu der Frage, ob Psychotherapie nur etwas für „Verrückte“ ist. In Deutschland sind innerhalb eines Jahres 27,8 % der erwachsenen Menschen psychisch erkrankt, das entspricht etwa 18 Millionen Menschen1. Diese Zahlen sind von 2008-2011; es ist davon auszugehen, dass die Zahlen inzwischen gestiegen sind. Dies zeigt auch der Bericht des Robert-Koch-Institutes, das für das Jahr 2023 angibt, dass 40,4% der Erwachsenen die Diagnose einer psychischen Erkrankung erhalten haben2. Langfristig betrachtet zeigt sich, das Lebenszeitvorkommen von psychischen Erkrankungen für Erwachsene bis zum Alter von 75 Jahren liegt bei ca. 50% 3 (EU-weit und auf Deutschland beziehbar). Das ist eine gewaltige Menge und bezieht nur die bekannten Fälle ein. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch deutlich höher, weil viele Menschen ihre Beschwerden aus Angst, Scham oder Unwissenheit nicht benennen und somit nicht in den Statistiken auftauchen. Wenn die Hälfte der Bevölkerung mindestens ein Mal im Leben mit einer psychischen Erkrankung zu kämpfen hat, können die dann alle verrückt sein?
Psychische Erkrankungen sind kein Randphänomen – sie sind Teil der Gesellschaft
Wir leben in einer Welt, in der oftmals zwischen „normal“ (der Mehrheit) und „abnormal“ (die Anderen) unterschieden wird. Doch genau diese Gegenüberstellung führt dazu, dass viele Betroffene sich nicht trauen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Denn psychische Erkrankungen als „anders“ oder „verrückt“ zu bezeichnen, stigmatisiert betroffene und ist ganz faktisch falsch. Wir sind in den letzten Jahrzehnten schon einen großen Weg der Entstigmatisierung bzw. Normalisierung von psychischen Erkrankungen gegangen. Das ist toll und wichtig. Die aktuellen Debatten schüren aber teilweise alte Ressentiments und das ist für die gesamte Gesellschaft nicht hilfreich.
Das Bild, dass psychisch kranke Menschen „verrückt“ seien, ist nicht nur falsch, sondern auch gefährlich: Es trägt dazu bei, dass Menschen leiden, ohne sich Unterstützung zu holen.
Jeder Mensch kann betroffen sein – und Hilfe anzunehmen ist kein Zeichen von Schwäche
Krisen, Belastungen oder Schicksalsschläge können jeden Menschen treffen – unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft oder Bildungsgrad. Dass es einem dann nicht gut geht, ist nicht verrückt, sondern menschlich. Und: Sich Unterstützung zu holen, ist nicht schwach – es ist klug.
Denn nur wer erkennt, dass etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist, kann auch wieder zurückfinden. Psychotherapie bedeutet, sich selbst ernst zu nehmen – und den eigenen Weg aus der Krise zu suchen. Und das ist alles andere als verrückt.
In meiner Praxis für Psychotherapie und Beratung in Berlin Schöneberg unterstützte ich Menschen bei psychischen Belastungen. Wenn Sie unsicher sind, ob Psychotherapie für Sie passend ist, kann ein unverbindliches Erstgespräch helfen, eine erste Orientierung zu bekommen.
Quellen:
2 Robert Koch-Institut. Psychische Störungen: Administrative Prävalenz (ab 18 Jahre). Gesundheitsberichterstattung des Bundes. 2024 [zitiert: 1. Juli 2025] Verfügbar auf https://gbe.rki.de
3 Kessler, R.C., et al. (2023). „The WHO World Mental Health Surveys: Global lifetime prevalence of mental disorders.“
Veröffentlicht in: The Lancet Psychiatry
Was denkst Du zu diesem Artikel? Hast Du Fragen? Schreibe es gern in die Kommentare